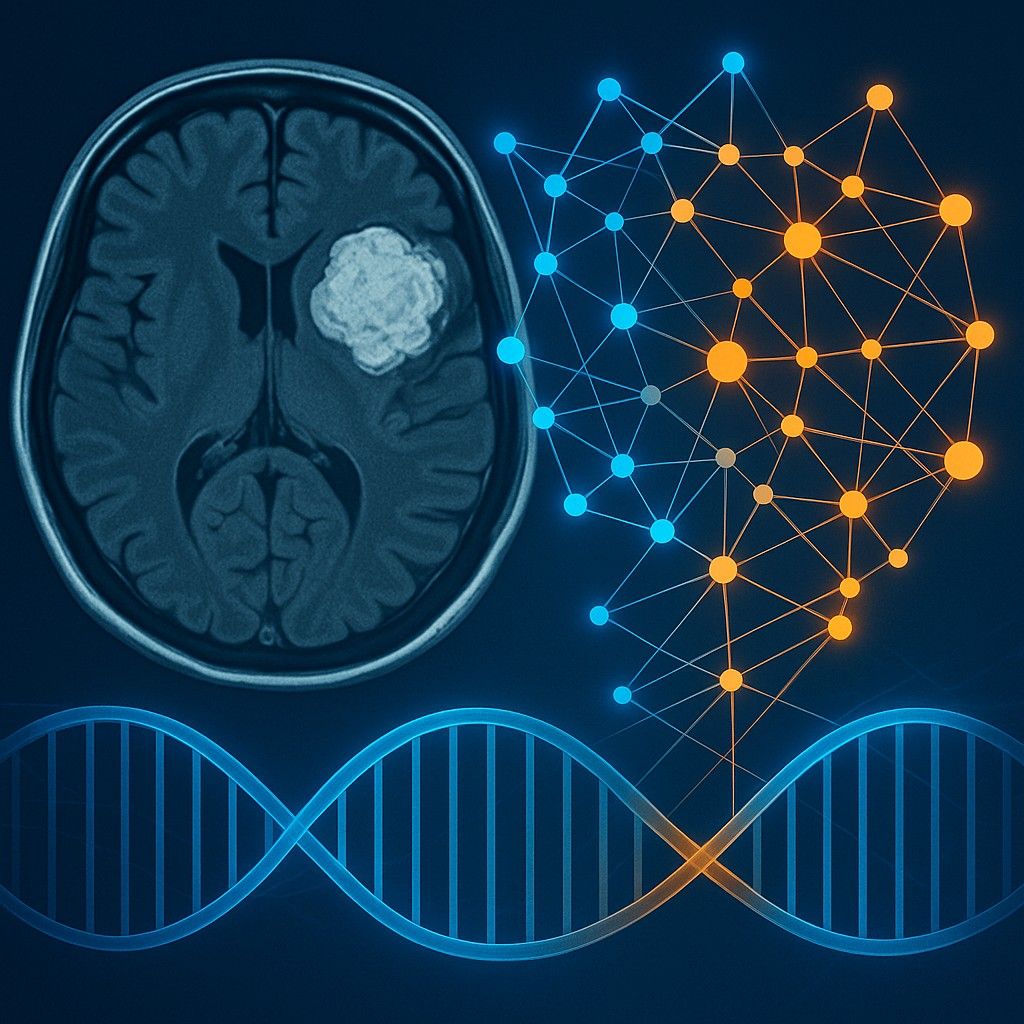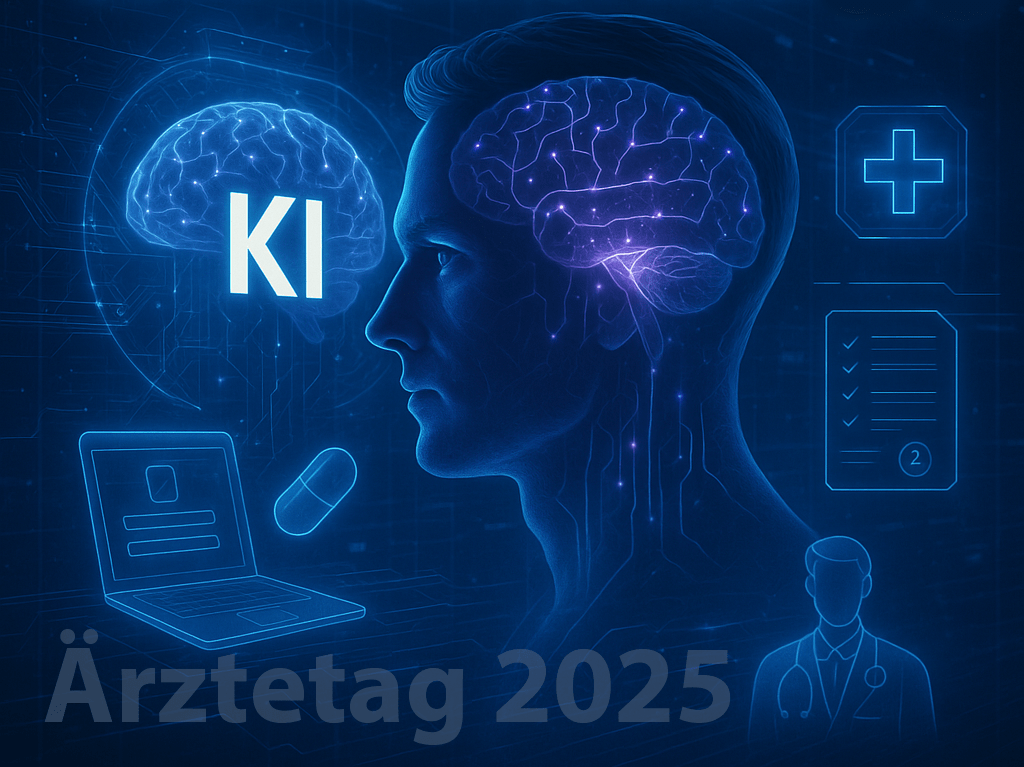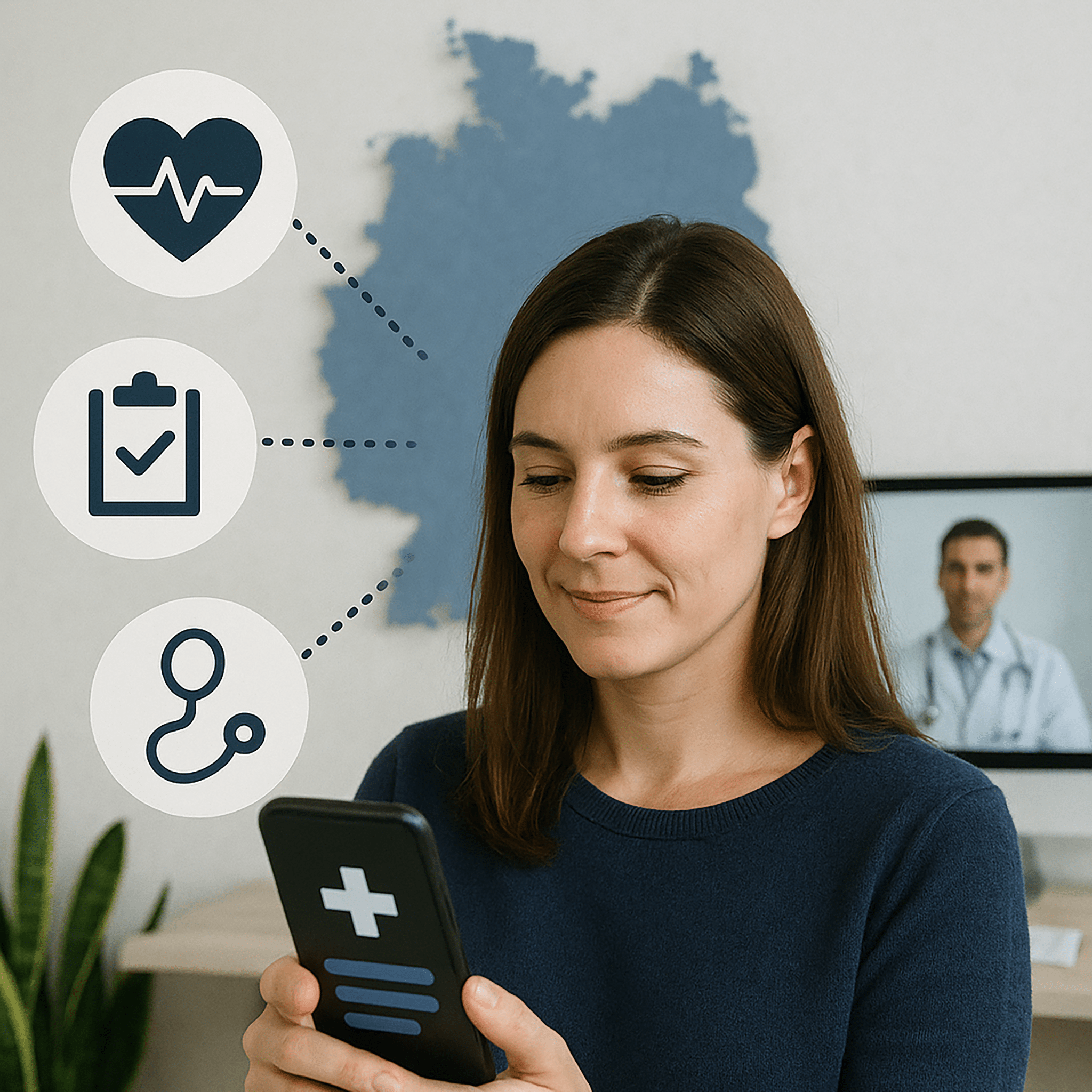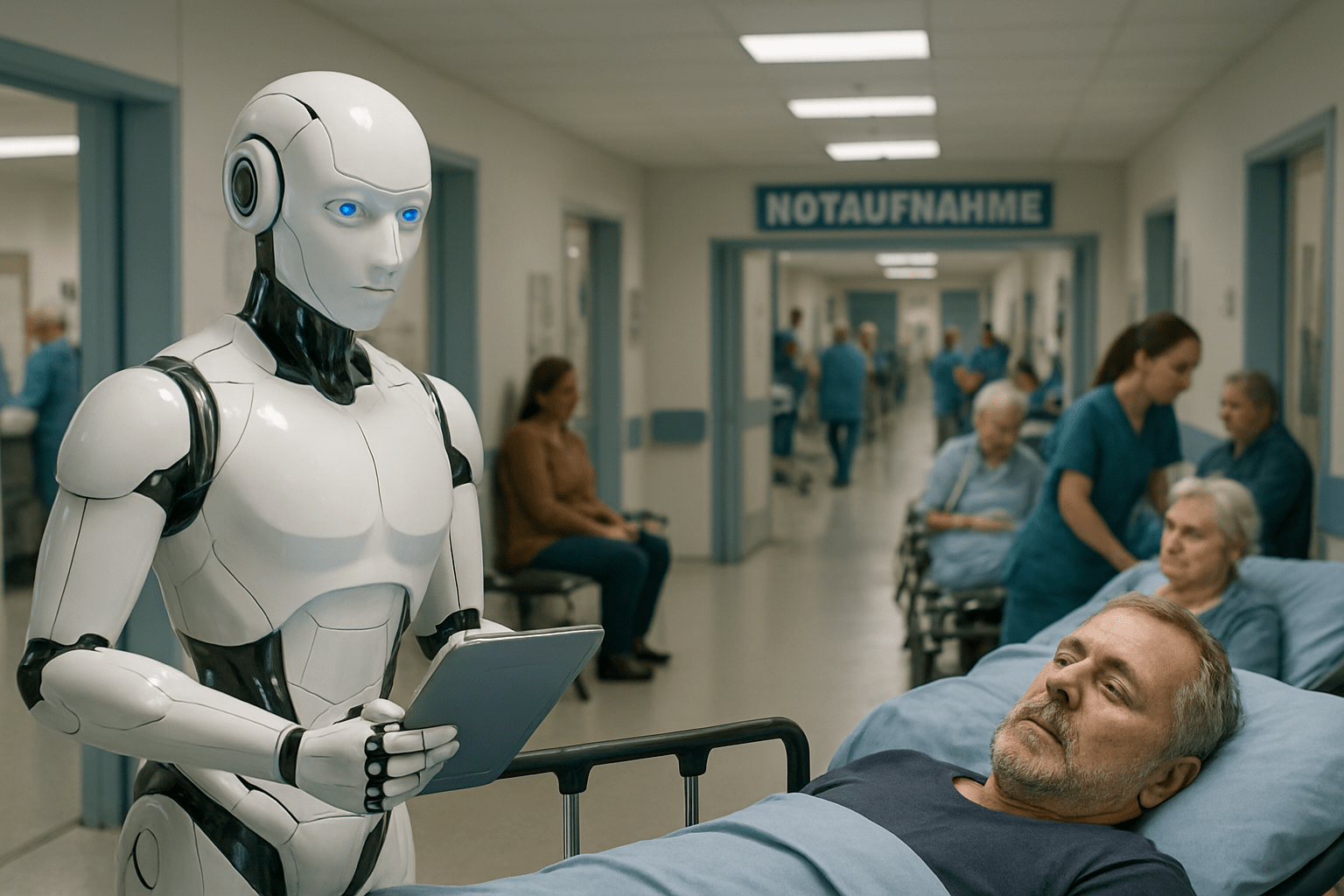Wie wichtig ist die Muttersprache in der medizinischen Kommunikation? Ein Einblick in die Herausforderungen und Chancen sprachlicher Vielfalt im Gesundheitswesen.
Welches ist eigentlich Ihre Muttersprache? Als ich kürzlich in einem Übersetzungskurs einer meiner Studentinnen – sie haderte etwas mit der deutschen Grammatik – diese Frage stellte, gab sie mir eine verblüffende Antwort: „Ich habe keine Muttersprache.“ Und sie erklärte mir das so: Man habe im Familienkreis zu etwa gleichen Teilen Spanisch und Portugiesisch gesprochen. Hier eine Präferenz zu benennen, fiel ihr schwer. Durch Auslandsaufenthalte erwarb sie dann noch gute Englisch- und Deutschkenntnisse, und es könnten durchaus noch weitere Sprachen dazukommen. Ob ein Mensch also tatsächlich die eine Muttersprache hat, scheint eine Frage der Definition zu sein.
Was also ist eine Muttersprache? In der Wissenschaft gehen die Ansichten darüber weit auseinander. Doch unabhängig davon, ob man darunter ausschließlich die Lingua materna, eine zusätzlich erworbene Sprache oder eine im Alltag vorrangig verwendete „Primärsprache“ verstehen mag, haben alle Sprachen eines gemeinsam: Sie grenzen sich durch ihre jeweiligen Schrift-, Laut- und Regelsysteme voneinander ab und benennen Phänomene somit unterschiedlich. Weniger bekannt dürfte sein, dass verschiedene Dinge, die ein Ganzes ergeben, in der einen Sprache durch ein einziges Wort benannt werden und in anderen Sprachen durch verschiedene Wörter. Den Satz „Ich habe mir den Fuß gebrochen“ versteht man im deutschen Sprachraum fast überall gleich: Die Fraktur befindet sich irgendwo zwischen der Fußwurzel und den Zehen. In anderen Sprachen kann das entsprechende Wort für „Fuß“ dagegen die gesamte untere Extremität bezeichnen. Das kennt man auch von manchen schwäbischen Dialekten: „Mir dean d’Fiaß weh“ kann sich auf schmerzende Oberschenkel, Knie oder Füße beziehen. Dieses Phänomen – man spricht hier von „Kolexifizierungen“ – wurde in jüngster Zeit aufwändig erforscht. In einer Studie wurden über 1800 Sprachen kontrastiv betrachtet und die Ergebnisse in einer Infomap, dem sogenannten CLICS-Cluster (von Cross-Linguistic Colexifications), visualisiert. Darin sind die Relationen zwischen Benennungen, Körperteilen und Sprachen anschaulich dargestellt. [1] [2] [3]
Der Ausdruck „gebrochener Fuß“ kann also, je nach Herkunft des Sprechers, etwas ganz Unterschiedliches bedeuten. In einer medizinischen Notfallsituation ist es daher von Belang, in welchen Muttersprachen die Beteiligten miteinander kommunizieren. Ob also in der Rettungsleitstelle eine Femurschaftfraktur (mit potenziell tödlichem Blutverlust) oder ein angeknackstes Fersenbein notiert wird, je nach Interpretation des Notrufs, macht für die Dringlichkeit des Ganzen schon einen Unterschied.
Fluch und Segen des Muttersprachenprinzips. Medizinische Fachübersetzer und Dolmetscher kennen diese Tücken. Und für ihr Tätigkeitsfeld gilt seit jeher eine Art „ungeschriebenes Gesetz“: Übersetzungen, erst recht im medizinischen Bereich, sollen nur von Muttersprachlern angefertigt werden. Diese Regel hat jedoch etwas Zweischneidiges und Unzeitgemäßes an sich. Wenn mit „Muttersprachler“ jemand gemeint ist, der neben höchster Fach- und Übersetzungskompetenz auch die Kultur, die Mentalität und die Lebenswirklichkeiten des Kulturkreises kennt, in dem die Zielsprache eingebettet ist, dann mag die Regel ihre Berechtigung haben. Doch wie wir gesehen haben, hat schon der Begriff der Muttersprache etwas Diffuses an sich. Bedenkt man zudem, dass es an deutschen Hochschulen nur für wenige Sprachen Ausbildungsgänge für Sprachmittler gibt, die zudem uneinheitlich und alles andere als flächendeckend sind, relativiert sich die Bedeutung des Muttersprachenprinzips schnell. Mehr noch: Es verselbständigt sich und wird zum vermeintlichen Schlüsselkriterium für Übersetzungskompetenz. Die Wirklichkeit sieht also oft genug so aus: Hat man erst einmal den unverzichtbaren Muttersprachler ausfindig gemacht (oder sich womöglich für eine „Relaisübersetzung“ über das Englische entschieden), werden ärztliche Befunde und Therapieplanungen am Krankenbett durch Pflegekräfte, Angehörige und andere persönlich involvierte Laien verdolmetscht, denen es meist an medizinischem Fachwissen, kultureller Kompetenz in beiden Richtungen und nicht zuletzt am Berufsethos eines Übersetzers fehlt. Letzteres beinhaltet unter anderem die Selbstverpflichtung zur Genauigkeit, Neutralität und Verschwiegenheit – alles Dinge, die nur selten in das Kompetenzprofil von Laien fallen. Der Bedarf an Sprachmittlung (speziell Dolmetschen) im Gesundheitswesen ist hoch, entsprechende Fachkräfte sind nicht immer leicht zu bekommen und die im Gemeinwesen bezahlten Honorare sind geradezu lächerlich. Nicht selten wird auch auf unbezahlte „Ehrenamtliche“ zurückgegriffen, was das Honorardumping weiter befeuert. Auch sind die Übersetzungsresultate von Laien häufig ungenau oder enthalten bewusste Verzerrungen, um den kranken Angehörigen zu schonen oder Sachverhalte subjektiv oder kulturspezifisch einzufärben.
Von Angehörigen der Heilberufe und ihren Standesvertretungen – und natürlich auch vom Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) – wird schon seit Jahren gefordert, den Weg für eine Kassenabrechnung von Übersetzungs- und Dolmetschleistungen im Gesundheitswesen freizumachen. Geht es nach dem Koalitionsvertrag der regierenden Ampelkoalition, sollen solche Leistungen zukünftig Bestandteil des Fünften Sozialgesetzbuchs (SGB V) werden. Ob es allerdings zur baldigen Umsetzung dieses Vorhabens kommt, ist ungewiss. Es wäre jedenfalls ein Schritt nach vorn, denn dann wäre auch der Weg frei für die Festlegung verbindlicher, einheitlicher Qualitätskriterien und Qualifizierungsmodelle. Ganz abgesehen von einem gesetzlich geregelten Honorarsystem, wie es etwa auf dem Gebiet der juristischen Sprachmittlung im Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) festgeschrieben ist. Wichtige Aspekte der medizinischen Sprachmittlung per Gesetz zu regulieren, könnte auch das Horrorszenario einer zunehmend maschinellen Übersetzung und Verdolmetschung im Gesundheitswesen abwenden. Denn schon heute sind Apps verfügbar, die dazu verführen, als kostenlose Übersetzungs- und Dolmetschgehilfen im Klinikalltag eingesetzt zu werden.
Autor: Armin Mutscheller (E-Mail: info@mutscheller.de)
Über den Autor: Studium an der Universität Heidelberg, Diplom-Übersetzer für Englisch und Französisch, parallel Ausbildung zum Rettungssanitäter mit 10-jähriger Tätigkeit in diesem Beruf. Spezialisiert auf medizinische und technische Fachübersetzungen, Terminologie-Management und Textredaktion, Beratung von zahlreichen Unternehmen in sprachlichen Fragen. Am Heidelberger Institut für Übersetzen und Dolmetschen unterrichtet er Studierende in gemeinsprachlichem und technischem Übersetzen und hält Vorträge zu berufspraktischen Themen.
Bild: leonardo.ai für arztCME
Literatur
[1] Tjuka, A., Forkel, R. & List, JM. Universal and cultural factors shape body part vocabularies. Sci Rep 14, 10486 (2024). https://doi.org/10.1038/s41598-024-61140-0
[2] Lexibank: https://lexibank.clld.org/
[3] CLICS-Cluster für „Bein“ vs. „Fuß“: https://clics.clld.org/graphs/subgraph_1301